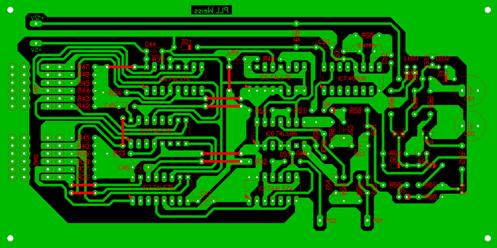
IPA
Herstellung einer Leiterplatine für einen
UKW- Sender
und Gleisbesetztmelder für die Modelleisenbahn
Verzeichnis
Herstellung einer Leiterplatine
Zurechtschneiden und Bohren der Platine
Anforderungen für einen mini UKW-Sender
Gleisbesetzmelder Schema und Layout
Ziel der IPA ist
es, einen UKW- Sender herzustellen, der portabel ist. Der Sender soll mit 12V
betrieben werden,
damit er im Auto zum Abspielen von externen Audioquellen
verwendet werden kann. Zudem soll er auch im
Wohnbereich, zum Verteilen von
Audiosignalen in einem Raum, eingesetzt werden können.
Der Sender soll
von Grund auf selbst gebaut werden. Dass heisst, das Layout der Leiterplatine
wird nach
Schema mit einer entsprechenden Software
selbst entworfen. Anschliessend wird die Platine
mit dem selbst hergestellten
Layout angefertigt. Dieser Vorgang beinhaltet das Belichten und das Ätzen der
Platine.
Die Herstellung
der Platine bildet den Schwerpunkt meiner IPA. Ich werde verschiedene Methoden
und Techniken
ausprobieren, um ein möglichst gutes Resultat zu erhalten. Die
daraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse
werden schriftlich wie auch mit
Bildern dokumentiert. Ausserdem vergleiche ich die verschiedenen Techniken
miteinander und zeige die Vorteile und Nachteile, die mir widerfahren sind,
auf.
Die Platine wird
anschliessend durchbohrt und mit den Bauteilen bestückt. Die fertige Schaltung
werde ich in ein
Gehäuse einbauen, damit der Sender problemlos transportiert
werden kann. Zudem wird ein ausführlicher Bericht
über die verschiedenen
Herstellungsschritte verfasst, so wie eine schriftliche Begründung weshalb
welche
Materialien und Techniken schlussendlich verwendet worden sind.
Ich teste in meiner IPA zwei verschiedene
Methoden, um Leiterplatinen herzustellen. Dies stellt auch den Schwerpunkt
meiner IPA dar. Ich erstelle selbst ein Layout, das ich mittels verschiedener
Techniken in eine Platine ätze.
Zum einen versuche ich, das ausgedruckte
Layout direkt auf die kupferbeschichtete Leiterplatte zu übertragen. Zum
anderen probiere ich die übliche Methode aus, bei welcher Leiterplatten, die
mit positivem Fotolack beschichtet sind,
belichtet werden.Bei beiden Arten verwende ich als
Leiterplatine, in Epoxidharz getränkte Glasfasermatten mit einer
Kupferschicht
von 35 μm. Diese besitzen gegenüber dem Hartpapier Vorteile wie, eine
bessere Kriechstromfestigkeit
und bessere
Hochfrequenzeigenschaften sowie eine
geringere Wasseraufnahme.
Ich werde die Vor- und Nachteile der beiden Methoden aufzeigen und mein Vorgehen dokumentieren.
-
Sprintlayout 4.0 zum Herstellen von Layouts
-
Folie für den Layoutausdruck
-
75 Watt Kryptonlampe zum Belichten
-
Einseitig kaschierte Epoxydharzplatine mit und
ohne Fotolack beschichtet
-
Natriumhydroxid zum Entwickeln
-
Natriumpersulfat zum Ätzen
-
Grammwage zum Abwägen der Chemikalien
-
Plastikschalen
-
Plastikhandschuhe
-
Verschiedene Hartmetallbohrer mit Durchmessern
von 0.8 mm bis 1.5 mm
-
Kleine Bohrmaschine mit Stand
-
Blechschere zum Zuschneiden der Platinen
-
Aceton zum Reinigen der Leiterplatinen
-
Katalog
Für die Erstellung des Layouts teste ich verschiedene Softwares die für alle zugänglich und einfach sind.
Dazu gehört das Eagle 4.16r2, das Target 3001 V12, das OrCAD
15.7 und das Sprint-Layout 4.0.
All diese Programme können kostenlos als
Freeware gedownloadet oder bestellt werden. Diese Freewares sind
allerdings ein
wenig eingeschränkt in der Platinengrösse oder in der Anzahl der Lötpunkte.
Zudem kann bei manchen
Freewares das Speichern von Projekten nicht realisiert
werden. Zum Testen der einzelnen Softwaren reichen sie
jedoch allemal.
Als erstes testete ich das Eagle 4.16r2, da
es laut der Beschreibung ein professionelles und einfach gestaltetes
Programm
sein soll. Zudem kann das Layout mittels gezeichnetem Schema automatisch
erstellt werden, was sich
zeitsparend auswirken sollte. Ausserdem hat die
Software eine grosse Bibliothek von den verschiedensten Bauteilen,
was das
Zeichnen des Schemas vereinfacht.
Beim Arbeiten mit dem Eagle stelle ich
fest, dass es ohne Erfahrung mit diesem Programm recht schwer ist, effizient
voranzukommen. Da es eine riesige Bibliothek mit sehr vielen Bauteilen und
Bauarten bietet kann man leicht den
Überblick verlieren. Dazu kommt, dass das
Hinzufügen von noch nicht vorhandenen Bauteilen mit grossem Aufwand
verbunden
ist. Dieser wäre für ein einmaliges Projekt wie meines zu hoch.
Da jedes Bauteil von Hand auf die Platine
gesetzt werden muss und der Autorouter schon bei kleiner Packungsdichte
mit einem
Layer überfordert ist und auf das zweite Layer wechselt. Deshalb konnte der
Autorouter meine
Erwartungen nicht erfüllen.
Beim Target wie beim OrCAD fand ich mich
überhaupt nicht zu recht, da die Programme wie das Eagle für den
professionellen Gebrauch gedacht sind und somit viele Funktionen bieten, die
ich gar nicht benötigte. Deshalb
entschloss ich mich, nicht viel Zeit zu
investieren, um diese Softwares kennen zu lernen, sondern lieber nach
einer
Alternative zu suchen.
Beim Sprint-Layout fand ich eine einfach
gehaltene Benutzeroberfläche mit einer Bibliothek, die leicht überschaubar
ist
und viele Möglichkeiten bietet. Dieses Programm beinhaltet alle Funktionen die
man benötigt, um ein Layout
herzustellen. Es besitzt wie alle anderen Softwares
einen Autorouter, wobei mich diese Funktion bei keinem der
getesteten
Layoutprogrammen überzeugt hat. Der einzige Nachteil des Sprint-Layouts
gegenüber den anderen
Softwares: Es können keine Schaltpläne gezeichnet werden.
Fazit: Das Eagle eignet sich für den professionellen
Bereich, da es bis zu 18 Layer erstellen kann und wegen dem
Umrechnen vom
Schema ins Layout Fehlerquellen minimiert. Für den einmaligen Gebrauch ist
dieses Programm
nicht geeignet da es viel Zeit braucht, um sich einzuarbeiten.
Dies gilt auch für das Target und das OrCAD: Beide
bieten viele Funktionen wie
z.B. das Ziehen von geschwungenen Linien.
Das Sprint-Layout hingegen benötigt keine
Vorkenntnisse, ist einfach gehalten, was verständlicher Weise mit
Einschränkungen verbunden ist. Beispielsweise können nicht mehr als 2 Layer
gezeichnet werden, was in meinem
Fall jedoch irrelevant ist, da ich sowieso nur
mit einseitig beschichteten Platinen arbeite.
Ich stelle meine Layouts mit dem
Sprint-Layot her, da dieses Programm alle für mich notwendigen Funktionen
beinhaltet.
Es ist sehr einfach aufgebaut und erlaubt deshalb ein effizientes
Arbeiten ohne grosse Vorkenntnisse.
PLL-Layout mit den Bauteilen
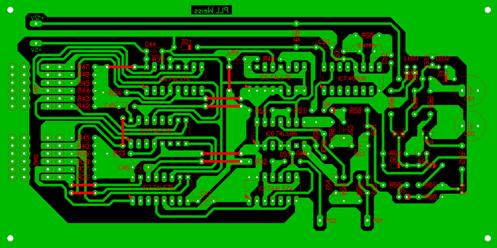
Netzteil- Layout mit Bauteilen

Sender-Layout mit Bauteilen
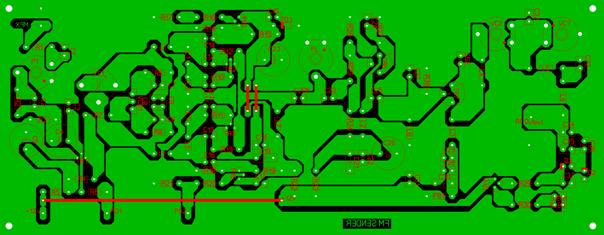

Ausschneiden des Layouts

 Nach dem Aufbügeln lasse ich die Platine auskühlen und lege sie
anschliessend
Nach dem Aufbügeln lasse ich die Platine auskühlen und lege sie
anschliessend
in kaltes Seifenwasser, damit sich das Papier lösen lässt ohne
den Toner zu
beschädigen. Zum Ablösen rubbelt man einfach fein mit dem Finger
auf der
Katalogseite herum. Dieser Vorgang benötigt Geduld und
Fingerspitzengefühl,
damit die Tonerbahnen nicht beschädigt werden.
Nun wird die Platine mit klarem Wasser
abgespült, um die Seifenrückstände
abzuwaschen. Anschliessend ist die Platine
zum Ätzen bereit.
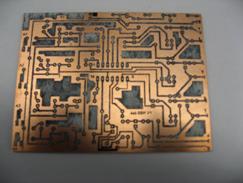

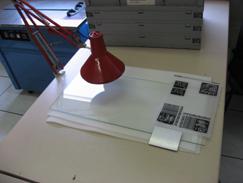 Zum Belichten einer mit positivem Fotolack beschichteten Platine
Zum Belichten einer mit positivem Fotolack beschichteten Platine
benötigt man eine Glühlampe mit UV Anteil. Je höher der UV Antei
l ist, desto
schneller wird der Lack belichtet. Damit die Platine nicht
überbelichtet wird
und sich beim späteren Entwickeln nur der
belichtete Lack vom Kupfer löst, muss
das Layout lichtundurchlässig
sein und die Belichtung darf nicht zu lange
andauern. Wird zu kurz
belichtet, kann es theoretisch sein, dass sich der Lack
beim Entwickeln
gar nicht lösen lässt. Ein zu langes oder zu kurzes Belichten
führt
also zu einem unbrauchbaren Endergebnis.
Ich verwende eine 75 Watt Krypton-Lampe von
Philips Type PF 603E/51 diese hat einen E25 Sockel.
Dank des E25 Sockels lässt
sie sich in herkömmliche Glühlampenfassungen drehen und somit leicht und ohne
grossen Aufwand installieren. Ein Lampenschirm erhöht den Wirkungsgrad der
Lampe. Zudem spielt der Abstand
eine wichtige Rolle: Je näher die Lampe zur
Platine gebracht wird, desto kürzer wird die Belichtungszeit.
Gleichzeitig
verringert sich aber auch die Streuwirkung der Lichtquelle. Wichtig ist, dass
die ganze Platine
gleichmässig belichtet wird. Bei Lampen mit grosser Leistung
muss zudem die Umgebungserwärmung bedacht
werden. Da die Lampen zum teil einen
hohen UV Anteil besitzen, ist es ratsam nicht direkt in die Lichtquelle
zu
blicken.
Ich benutze einen Abstand von 10 cm, der
sich bewährt hat. Da meine Lampe mit 75 Watt nicht so
leistungsstark ist, habe
ich auch keine Probleme mit der Umgebungserwärmung.
Auf den Tisch lege ich einen Schaumstoff.
Dieser dient dazu, den Höhenunterschied der Platine auszugleichen,
damit die
Glasplatte flach aufliegen kann. Auf diesen Schaumstoff lege ich nun die
Platine mit dem darauf
ausgerichteten Layout. Das Layout wird mit der
bedruckten Seite auf die Platine gelegt, damit der Abstand
möglichst klein ist
und kein Streulicht darunter fällt. Damit das Layout wirklich
lichtundurchlässig wird, lege ich
jeweils zwei deckungsgleich aufeinander und
klebe sie mit Klebestreifen zusammen. Am besten eignet sich
dafür ein
Lichtpult. Wer so was nicht besitzt, kann wie ich eine Glasscheibe mit darunter
aufgestellter
Schreibtischlampe verwenden oder notfalls das Fenster benutzen.
Es ist hilfreich, wenn man Passkreuze auf
den Layouts anbringt, da diese das
genaue Aufeinanderlegen enorm erleichtern.
Die Glasplatte dient dazu, dass das Layout
nicht verrutscht und flach auf der Platine zu liegen kommt. Nicht
jede
Glasplatte eignet sich gleich gut, da heisst es einfach ausprobieren.
Zum Eruieren der richtigen Belichtungszeit
müssen verschiedene Zeiten unter den gleichen Bedingungen
ausprobiert werden.
Beim anschliessenden Entwickeln zeigt sich, welche Belichtungszeiten zu kurz
und welche
zu lang waren. Somit kann die ideale Belichtungszeit ermittelt
werden.
Das Entwickeln ist nur bei der
Belichtungsmethode notwendig. Als Entwickler verwende ich Natriumhydroxyd,
da
es der einzige Entwickler ist, den ich bestellen konnte. Da Conrad keine
Entwickler und Ätzmittel mehr
vertreibt, habe ich mir die Chemikalien über
Distrelec besorgen müssen. Natriumhydroxid ist sehr toxisch und
muss deshalb
als Giftmüll entsorgt werden. Die meisten Gemeinden bieten eine kostenlose
Entsorgung von
Giftmüll an, solange es sich um kleinere Mengen handelt und die
Chemikalien nur privat und nicht industriell
genutzt wurden.
Das Entwickeln kann von wenigen Sekunden
bis zu 4 Minuten dauern. Bei mir dauerte der Entwicklungsvorgang
ca. 15 bis 20
Sekunden. Dazu löse ich zwei Gramm Natriumhydroxyd in zwei Deziliter kaltem
Wasser.
Der Entwicklungsvorgang ist abgeschlossen,
sobald das Layout auf dem Kupfer deutlich erkennbar ist.
Dabei ist zu beachten,
dass die Stellen, an welchen später das Kupfer weggeätzt werden soll, wirklich
keinen
Fotolack mehr aufweisen. Doch Vorsicht: All zu lange darf die Platine
nicht im Entwickler bleiben,
da ansonsten eine Überentwicklung statt findet,
d.h. der nicht belichtete Fotolack löst sich allmählich
von dem Kupfer. Dieser
Effekt kann zu Leiterbahnenunterbrüchen führen und somit das Endergebnis
unbrauchbar machen.
Nach dem Entwickeln kann das Entwicklerbad
aufbewahrt werden. Dazu kann man die Arbeitsschale mit einer
Folie abdecken und
das Bad somit vor Staub schützen.
Merke: Die Platine sollte nicht zulange,
aber auch nicht zu kurz entwickelt werden.
Nach dem Entwickeln muss die Platine sofort
unter fliessendem Wasser gründlich abgespült werden,
damit der Entwickler sie
nicht weiter entwickelt.
Anschliessend lässt man die Platine am
besten an der Luft trocknen. Wenn sie mit einem Tuch abgetrocknet wird,
beschädigt
man eventuell den Lack. Dies kann zu Unterbrüchen und Löchern in den
Leiterbahnen führen.

Die Toner direkt Methode benötigt Geduld
und Erfahrung, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Da der
Toner immer ein
bisschen verläuft, eignet sich diese Methode besser für einfache Schaltungen
mit grösseren
Abständen zwischen den Leiterbahnen. Auch der Aufwand ist etwas
höher als beim Belichten, da das Layout
aufgebügelt werden muss und später das
Papier wieder abgelöst wird. Dennoch besitzt diese Variante den
entscheidenden
Vorteil, dass immer wieder angefangen werden kann, wenn das Layout nicht sauber
auf das
Kupfer gebracht wurde, denn mit Aceton lässt sich der aufgebügelte
Toner leicht entfernen und anschliessend
kann wieder von vorne begonnen werden.
Zudem braucht man keinen Entwickler. Dies bedeutet, dass die
Herstellung
umweltfreundlicher wird. Somit eignet sich diese Methode hervorragend zum
Herstellen von
einfachen Leiterplatinen für den privaten Gebrauch.
Die Belichtungsmethode eignet sich für das
mehrmalige Herstellen von derselben Leiterplatine, da das Layout
nur einmal auf
eine Folie ausgedruckt werden muss. Danach kann es unbeschränkt zum Belichten
von Platinen
eingesetzt werden. Mit dieser Technik kann eine sehr hohe Konturenschärfe
erreicht werden. Dafür sind die
Materialkosten etwas höher, da man eine
Belichtungslampe, fotolackbeschichtete Platinen und ein Entwicklerbad
benötigt.
Diese Kosten zahlen sich, meiner Meinung nach, aus, wenn man öfters selber
Platinen herstellt.
Weil meine Layouts feine und eng
beieinander liegende Leiterbahnen haben, verwende ich die Belichtungsmethode,
da ich mit dieser Technik eine höhere Konturenschärfe erzielen kann. Ausserdem
begibt man sich nicht in Gefahr,
das Layout von Hand zu beschädigen wie bei der
Toner direkt Methode.
| Links die Toner direckt methode beim Ätzen, rechts die Fotolack beschichtete. |
Ersichtlicher Ätzvorgang | Ätzen des Platine |
 |
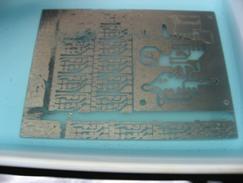 |
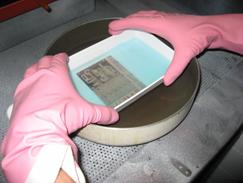 |
Ich verwende zum ätzen Natriumpersulfat, da es
umweltfreundlicher und weniger gefährlich ist als das
Eisen III Chlorid.
Trotzdem ist im Umgang mit Chemikalien Vorsicht geboten: Am besten schützt man
die
Hände mit Plastikhandschuhen und vermeidet Spritzer. Für zwei Deziliter
kaltes Wasser benötigt man ca.
40 Gramm Natriumpersulfat. Der Nachteil ist,
dass das Ätzbad auf ca. 40-50°C geheizt werden muss,
damit es seine volle Wirkung entfalten kann.
Vorsicht die Ätzlösung sollte immer mit kaltem Wasser angerührt
werden, da beim
Lösen des Natriumpersulfat eine Wärmeentwicklung stattfindet. Am besten
verwendet
man eine Ätzmaschine mit integrierter Heizung. Sie stellt auch die
ständige Bewegung des Ätzbades und
die Sauerstoffzuführung für den optimalen
Ätzvorgang sicher. Leider sind diese Anlagen relativ teuer und
eine Anschaffung
somit nur sinnvoll, wenn man regelmässig Platinen herstellt. Für das
gelegentliche Ätzen
reicht eine handelsübliche Plastik- oder Arbeitsschale, wie
sie im Conrad Katalog angeboten wird, durchaus aus.
Diese kann in einem
Wasserbad in einer alten Pfanne erwärmt werden, so dass das Ätzbad temperiert
wird.
Durch leichtes Hin- und Herschwenken der Schale wird das Ätzbad in
Bewegung gehalten und mit Sauerstoff
versorgt. Dies beschleunigt den
Ätzprozess. Der Ätzvorgang dauert in der Schale länger als in einer
Ätzmaschine,
da die Platine horizontal und nicht wie in den Ätzapparaturen
vertikal steht. Zu dem kommt, dass die Temperatur
mit dem Wasserbad nicht so genau
eingehalten werden kann.
| Fertige Platine für den UKW Sender | |
 |
Da das
Ätzbad nach dem Ätzen mit Kupfer angereichert ist muss es wie der Entwickler
als Sondermüll entsorgt
werden. Das Ätzbad kann nicht längere zeit aufbehalten
werden, da es mit der Umgebungsluft reagiert und
auskristallisiert. Da beim
Reagieren mit Kupfer Gase entstehen darf die Lösung zum Entsorgen nicht
luftdicht
aufbewahrt werden.
Die Platine kann nach dem Ätzen noch
zurechtgeschnitten oder auseinander geschnitten werden.
Dafür benutze ich eine
normale Blechschere. Dies funktioniert erstaunlich gut und präzise. Man sollte
darauf achten, dass die Schere in einem guten Zustand ist, da der Schnitt
ansonsten nicht sauber gelingt.
Um die Lötaugen zu durchbohren, eignet sich
am besten eine kleine Bohrmaschine wie z.B. ein Dremel.
Zur Not kann man auch
eine Standbohrmaschine verwenden. Diese eignet sich aber nicht so gut, da sie
zu gross ist. Für die Löcher verwende ich 0.8mm, 1mm und 1.2mm Bohrer.
| Durchbohrte Platine | Schneiden der Platine | Blechschere zum zuschneiden der Platine |
 |
 |
 |
Am besten reinigt man die Platine erst nach dem Zuschneiden und
Bohren, da sowohl
der Toner als auch der Fotolack eine Schutzschicht darstellt.
Vor allem beim Bohren
ist es von Vorteil, wenn das Kupfer bedeckt ist und nicht
spiegelt, da ansonsten bei
der Arbeit die Sicht beeinträchtigt wird.
Den Bau des UKW-Senders habe ich unterschätzt.
Ich wollte einen erstklassigen Sender
herstellen, der den Anforderungen der Bakom entspricht und qualitativ
hochstehend ist. Mein Ziel, einen Stereosender zu bauen, musste ich jedoch aus
Zeitgründen aufgeben,
da sich die Arbeiten als wesentlich zeitaufwendiger
erwiesen als ich mir das vorgestellt habe.
Ich recherchierte im Internet und schaute
mir diverse Schaltungen an, die angeboten wurden. Viele waren
sehr einfach
aufgebaut, doch wurde immer davor gewarnt, dass der Sender womöglich nicht
frequenzstabil
arbeitet und somit meiner Vorstellung nicht entsprechen würde.
Deshalb entschloss ich mich, einen Sender
mit einer PLL-Schaltung auszuwählen,
damit die Frequenz sicher stabil ist.
Da ich davon ausging, dass die
Sendefrequenz mittels des PLLs einzustellen ist, machte ich mir noch keine
Gedanken darüber, dass die Filter am Ausgang für jede Frequenz abgeglichen
werden müssen.Zudem achtete
ich darauf, dass der Sender
einen Filter besitzt, damit wirklich nur die Sendefrequenz gesendet wird.
Dies hatte zur Folge, dass der Sender
relativ komplex und in den Abmessungen grösser als eigentlich geplant wurde.
Leider musste ich die Erfahrung machen,
dass nicht alles, was im Internet angeboten wird, von Fachleuten
online
gestellt wird. So stellte sich mit der Zeit heraus, dass die dazugehörige
Stückliste teilweise nicht zum
Schema passte. Daraufhin kontaktierte ich den
Betreiber dieser Website. Trotz einigen Fehlinformationen
gelang es mir
schlussendlich mit einigem Zeitaufwand, den Sender fertig zu stellen.
In der Schweiz dürfen Minisender, welche
den UKW-Frequenzbereich (87.5-108 MHz) nutzen, unter bestimmten
Voraussetzungen
in Betrieb genommen werden. Damit der Handel und die Inbetriebnahme solcher
UKW-Minisender erlaubt ist, müssen unter anderem folgende Grundregeln
eingehalten werden:
- Die maximale Strahlungsleistung darf 50 nW e.r.p. nicht überschreiten.
- Die elektrische Sicherheit und der Schutz der Gesundheit
müssen gewährleistet sein, d.h. dass durch die
Anlage, weder Personen, noch Haustiere
oder Eigentum gefährdet werden dürfen.
- Die Anlage darf andere Anlagen nicht stören und muss selber
eine gewisse Störfestigkeit aufweisen.
(Elektromagnetische Kompatibilität)
- Die Anlage soll nur das zur Übertragung der Information
notwendige Frequenzspektrum verwenden.
Die nicht relevanten Aussendungen werden
eingeschränkt. (Effiziente Nutzung des Spektrums)
-
Der Nutzer muss die Möglichkeit haben, einen
Sendekanal im gesamten UKW-Frequenzbereich
(87.5 bis 108 MHz) frei zu wählen.
Diese Richtlinien können bei der Bakom nachgelesen werden.
| PLL Platine mit den Widerständen bestückt | PLL Platine mit den IC-Sockeln |
 |
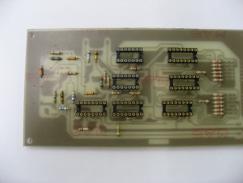 |
| mit den Kondensatoren | PLL Platine von der Lötseite |
 |
 |
Damit keine kalten Lötstellen auftreten, wird von der einen Seite
das Lötauge und das Bauteilbein erwärmt, von der
anderen Seite gibt man nun
Lötzinn dazu. Diese Technik hat den Vorteil, dass der Zinn erst dann zu
fliessen beginnt,
wenn wirklich beide Materialien genug erwärmt wurden, um sich
mit dem Zinn zu verbinden.
Zum Abgleichen des UKW-Senders wird die
gewünschte Frequenz mittels zwei Dip-Schaltern nach der
Schalterstellungsliste
eingestellt. Anschliessend muss der Drehkondensator 1 (im Schema VC1) solange
abgeglichen
werden, bis die Leuchtdiode 2 (im Schema LED2) am PLL aufleuchtet.
Um das Filter am Ausgang abzugleichen,
verwende ich einen Frequenzbandanalyser,
damit ich optimal abgleichen kann. Dabei muss mit dem Drehkondensator 2,
der
Spule 4,5 und 6 (im Schema VC2, L4, L5 und L6) experimentiert werden, solange bis
möglichst nur noch das
Trägersignal vorhanden ist. Die Spulen werden mit
auseinander ziehen und zusammendrücken abgestimmt.
Da neben dem Sender eigentlich noch ein
Stereo-Coder vorgesehen war, den ich leider nicht mehr realisieren konnte,
musste
ich mich auch beim Gehäuse anpassen. Die Abmessungen des Gehäuses betragen
LxBxH: 203 mm x 100 mm x 63 mm.
Ich verwende ein Aluminiumgehäuse, damit
der Sender nach aussen abgeschirmt ist. Damit der Sender den PLL nicht
stört,
schirme ich ihn mittels einer 2 mm dicken Aluminiumplatte ab. Ich habe extra
eine dicke Platte gewählt, damit ich
Gewinde schneiden kann und somit die
Montage der einzelnen Platinen erleichtert wird.


Wenn ich auf die vergangenen Wochen
zurückblicke, stelle ich fest, dass das Herstellen eines Gerätes nicht so
einfach ist, wie ich mir dies zuerst vorgestellt habe. Im Bezug auf Materialien
und Techniken gilt es viele Details zu
beachten: Was eignet sich für welchen
Verwendungszweck am Besten?, Welches sind Vor- und Nachteile?
und so weiter.Schon beim Erstellen des Layouts stiess ich
auf ungeahnte Schwierigkeiten. Oft mussten
Leiterbahnen und Bauteile
versetzt
oder gelöscht werden, damit das gewünschte Ziel erreicht werden konnte.
Ich habe bei der Arbeit viel gelernt, da
ich beim Herstellen von Platinen auf keine Vorkenntnisse zurückgreifen konnte.
Zudem war es interessant zu sehen, wie Platinen hergestellt werden, da ich in
meinem Beruf tagtäglich mit ihnen
konfrontiert werde.
Abschliessend kann ich sagen, dass sich der
Aufwand gelohnt hat und ich eine gute Arbeit präsentieren darf, auch wenn
sie
sicherlich noch verbesserungsfähig wäre. Wenn ich mir jedoch vor Augen halte,
dass es sich bei meiner Arbeit um
einen Prototypen handelt und ich mir alles
selbst erarbeitet habe, blicke ich doch mit etwas Stolz auf mein Endprodukt.
Internet:
18.04.07: Material sowie Schema und Stückliste für den UKW-Sender besorgen.
19.04.07 Layout-Programm suchen und ausprobieren.
20.04.07 Zeichnen der Layouts.
21.04.07 Ausdrucken der Layouts und Ätzen der Platinen.
Toner direkt Methode durchführen.
25.04.07 Bestücken der Platinen.
26.04.07 Erste Inbetriebnahme des Senders.
Fehlersuche, Abklärung der Stückliste.
27.04.07 Fehlersuche, Abklärung der Stückliste.
28.04.07 Sender in das Gehäuse einbauen.
03.05.07 Schreiben der Dokumentation.
04.05.07 Schreiben der Dokumentation.
05.05.07 Fertigstellung der Dokumentation.
|
Widerstände |
Kondensatoren |
|||||||||
|
R1 |
47 |
|
R35 |
1.5k |
|
C1 |
100p |
|
C32 |
10p |
|
R2 |
27k |
R36 |
1.5k |
C2 |
1n8 |
C33 |
47p |
|||
|
R3 |
8.8k |
R37 |
1.5k |
C3 |
100p |
C34 |
22p |
|||
|
R4 |
10k |
R38 |
1.5k |
C4 |
10uF Elko |
C35 |
1p8 |
|||
|
R5 |
3.3k |
R39 |
1.5k |
C5 |
47uF Elko |
C36 |
1p8 |
|||
|
R6 |
100k |
R40 |
1.5k |
C6 |
68p |
C37 |
1n |
|||
|
R7 |
6.8k |
R41 |
1.5k |
C7 |
68p |
C38 |
100n |
|||
|
R8 |
3.3k |
R42 |
1.5k |
C8 |
22p |
C39 |
220uF Elko |
|||
|
R9 |
3.3k |
R43 |
1.5k |
C9 |
15p |
C40 |
10n |
|||
|
R10 |
120 |
R44 |
1.5k |
C10 |
1n |
C41 |
10n |
|||
|
R11 |
120 |
R45 |
1.5k |
C11 |
1n |
C42 |
10n |
|||
|
R12 |
68k |
R46 |
1.5k |
C12 |
15p |
C43 |
1n |
|||
|
R13 |
68k |
R47 |
1.5k |
C13 |
15p |
C44 |
100n |
|||
|
R14 |
22k |
R48 |
1.5k |
C14 |
22p |
C45 |
100n |
|||
|
R15 |
15k |
R49 |
470 |
C15 |
1n |
C46 |
100n |
|||
|
R16 |
150 |
R50 |
100k |
C16 |
22p |
C47 |
100n |
|||
|
R17 |
330 |
R51 |
1.5k |
C17 |
1n |
C48 |
100n |
|||
|
R18 |
22k |
R52 |
4.7k |
C18 |
1n |
C49 |
100n |
|||
|
R19 |
15k |
R53 |
1.5k |
C19 |
10n |
C50 |
100n |
|||
|
R20 |
150 |
R54 |
10k |
C20 |
1n |
C51 |
1n |
|||
|
R21 |
330 |
R55 |
22k |
C21 |
10n |
C52 |
100p |
|||
|
R22 |
150 |
R56 |
1.5k |
C22 |
1n |
C53 |
33p |
|||
|
R23 |
22 |
R57 |
5.6k |
C23 |
220 uF Elko |
C54 |
220n |
|||
|
R24 |
6.8k |
R58 |
12k |
C24 |
1n |
C55 |
100n |
|||
|
R25 |
10 |
R59 |
12k |
C25 |
47p |
C56 |
10n |
|||
|
R26 |
4.7k |
R60 |
47k |
C26 |
47uF Elko |
C57 |
220n |
|||
|
R27 |
33 |
R61 |
5.6k |
C27 |
47p |
C58 |
4n7 |
|||
|
R28 |
150 |
R62 |
2.2k |
C28 |
100p |
C59 |
10n |
|||
|
R29 |
1.5k |
R63 |
270 |
C29 |
1n |
C60 |
220uF Elko |
|||
|
R30 |
270 |
R64 |
560 |
C30 |
10n |
C61 |
220uF Elko |
|||
|
R31 |
22 |
R65 |
33 |
C31 |
1n |
VC1 |
40p Trimmer |
|||
|
R32 |
1k |
R66 |
56 |
|
VC2 |
65p Trimmer |
||||
|
R33 |
1.5k |
R67 |
15 |
VC3 |
65p Trimmer |
|||||
|
R34 |
1.5k |
VR1 |
10k Poti |
|
|
|||||
|
Halbleiter und diverses |
||||
|
TR1 |
BC558 |
|
IC1 |
74ALS74 |
|
TR2 |
BF494 |
IC2 |
74LS193 |
|
|
TR3 |
BF494 |
IC3 |
74LS193 |
|
|
TR4 |
BF494 |
IC4 |
74LS193 |
|
|
TR5 |
BF494 |
IC5 |
74LS76 |
|
|
TR6 |
2N4427 |
IC6 |
74LS86 |
|
|
TR7 |
2N4427 |
IC7 |
4060 |
|
|
TR8 |
BC548 |
IC8 |
5 V 1 Ampere Spannungsregler 7805 |
|
|
TR9 |
BC558 |
L1 |
6 * 2 Wdg. 6 mm Innendurchmesser |
|
|
TR10 |
BC548 |
L2 |
4 Wdg. 6 mm |
|
|
TR11 |
BC548 |
L3 |
4 Wdg. 5 mm |
|
|
VCD1 |
KV1310 |
L4 |
4 Wdg. 5 mm |
|
|
D1 |
1N4001 |
L5 |
6 Wdg. 6 mm |
|
|
D2 |
1N4148 |
L6 |
6 Wdg. 6 mm |
|
|
D3 |
1N4148 |
FB1 |
5 Wdg. durch Ferrit |
|
|
D4 |
1N4148 |
FB2 |
5 Wdg. durch Ferrit |
|
|
D5 |
1N4148 |
FB3 |
1 Wdg. durch Ferrit |
|
|
D6 |
1N4148 |
FB4 |
5 Wdg. durch Ferrit |
|
|
D7 |
1N4148 |
FB5 |
5 Wdg. durch Ferrit |
|
|
ZD1 |
7.5 Volt Zener |
XTAL1 |
6.4 MHz Kristall |
|
|
ZD2 u.3 |
7.5 Volt Zener |
SW1 |
6-fach DIP Switch |
|
|
LED1 |
5 mm LED gelb |
SW2 |
6-fach DIP Switch |
|
|
LED2 |
5 mm LED grün |
SKT1 |
Chinch-Buchse |
|
|
LED3 |
5mm LED rot |
|
|
|
Schema des Gleisbesetztmelders
| Schema. | |
 |
Für grössere Ansicht bitte anklicken ! |
| Layout Lötseite. | Layout Bestückungsseite Spiegelverkehrt. |
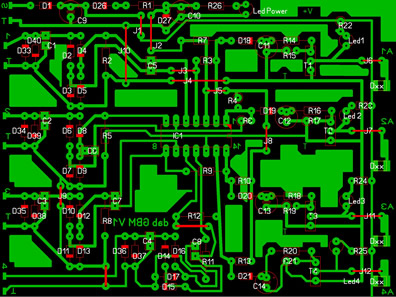 |
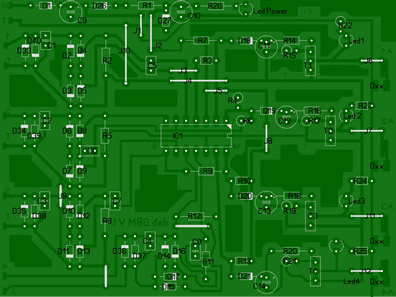 |
| ohne Bestückung. | Lötseite Spiegelverkehrt. |
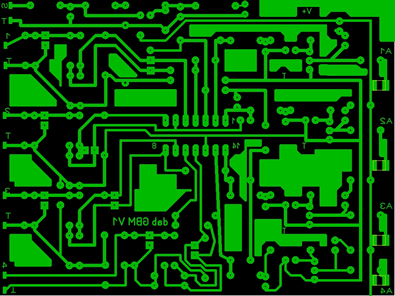 |
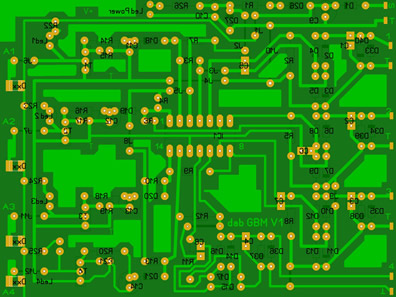 |
|
WAS
|
Position
|
Wert
|
| Widerstand | R1 | 470 |
| Widerstand | R4, R7, R10, R13, R14, R16, R18, R20 | 10k |
| Widerstand | R2, R3, R5, R6, R8, R9, R11, R12 | 470k |
| Widerstand | R15, R17, R19. R21 | 47k |
| Widerstand | R22 - R 26 | 1,5k |
| Kondensator | C1 - C8 | 100nF |
| Kondensator | C9, C10 | 220uF 35V |
| Kondensator | C11 - C14 | 22uF 25V |
| Diode | D1 | 1N5400 |
| Diode | D2 - D26 | 1N4148 |
| Diode | D33 - D40 | 1N4007 |
| Z-Diode | D27 | 12 Volt ZPD |
| LED | Led 1 - Led 5 | Standart 3mm |
| Transistor | T1 - T4 | BD 139 |
| IC | IC 1 | LM 339N |
Alle gemachten Angaben ohne Gewähr. Anwendung auf eigene Gefahr und ohne Garantie!
Fazit
Das Nachbauen eines Gleisbesetztmelders ist nur für die, die Spass und die Einrichtung dazu schon haben.
Grundsätzlich
lohnt es sich kaum. Für ein paar wenige Euro oder Franken bekommt man diese Fertig oder im
Bausatz von
verschiedenen Hersteller. Die wohl im Preis Leistung besten kommen aus dem Hause
Tams oder Littfinski.